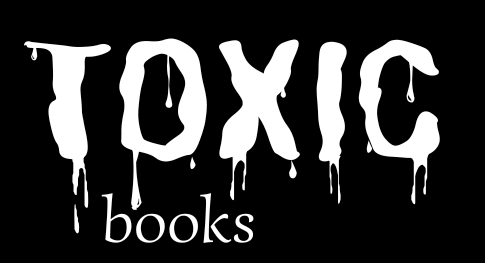Kurzgeschichte über Suizid
Die Nacht ist kalt. Die Gleise sind es erst recht. Aber damit hatte ich gerechnet. Würde ja auch nicht mehr allzu lange dauern. Die Kälte kriecht in meine Jacke. Ich hätte vielleicht eine zweite Hose anziehen sollen. Wozu? frage ich mich sofort. Es bleibt keine Zeit mehr, um mich zu erkälten. Ein irgendwie tröstlicher Gedanke. Ich schließe die Augen und lausche der Stille. Von fern kann ich die Autobahn hören. Ein Flugzeug dröhnt durch die Nacht. Der Flughafen ist gar nicht so weit weg. Etwas piekst mich in die Hand. Eine Tannennadel. Hoffentlich kriecht mir keine Spinne ins Hosenbein, denke ich. Es schaudert mich. Ganz ruhig, sage ich mir noch einmal. Es ist bald vorbei.
Da höre ich es. Ein – Grummeln wie von entferntem Donner. Zunächst. Doch es wird lauter. Sehr schnell lauter. 320 Tonnen Stahl kreischen heran. Der ICE nach Berlin. Ausnahmsweise pünktlich. Die Nacht ist klar. Ich kann bereits die Lichter des Zuges erkennen.
Da werde ich gepackt, in die Höhe gerissen und herumgeschleudert. Ein kurzer Flug durch die Nacht, dann lande ich hart auf dem Rücken. In ein paar Metern Entfernung donnert der ICE vorbei. Ich liege still. Mein Herz muss einen Moment lang ausgesetzt haben, doch jetzt setzt es wieder ein – und zwar mit aller Macht, so, als ob es zerspringen will. Ein Schatten mit starkem Schweißgeruch beugt sich über mich. Ich kann das Gesicht in der Dunkelheit nicht erkennen, doch die Stimme klingt sehr kräftig, die mich aus vollem Hals anbrüllt: „Bist du lebensmüde?“
Ich zucke tatsächlich zusammen. Nach was sieht es denn aus, denke ich mir dann benommen. Mein Herz klopft immer noch wie verrückt. Wie haarscharf bin ich gerade dem Tod entronnen. So war das eigentlich nicht geplant. Aber in diesem Moment bin ich doch fast – erleichtert. Der Mann hilft mir, mich aufzusetzen. Er atmet keuchend. Anscheinend ist die ganze Aktion auch nicht komplett spurlos an ihm vorübergegangen.
„Bist du ok?“ fragt er mich schließlich.
„Ja“, flüstere ich.
Er sitzt neben mir und starrt in die Dunkelheit.
„Was soll ich jetzt mit dir machen?“ fragt er.
Ich zucke die Achseln.
„Ich werde die Polizei rufen müssen“, murmelt er, wohl mehr zu sich selbst als zu mir.
„Nein!“ rufe ich erschrocken aus. Alles, nur das nicht.
„Dann fahre ich dich ins Krankenhaus.“
„Nein!“ Meine Stimme klingt so verzweifelt, wie ich mich fühle.
„Ich kann dich hier nicht sitzen lassen“, sagt der Mann fest. „Gibt es jemanden, der sich um dich kümmern kann?“
Ganz klar versucht er, die Verantwortung loszuwerden, die er für mich zu haben glaubt.
„Ich – ich komm klar“, sage ich mit zittriger Stimme. „Ich werde es nicht wieder tun.“
„Hm.“ Er wirkt überhaupt nicht überzeugt. „Warum hast du es überhaupt getan?“ fährt er nach kurzem Schweigen mit seinem Verhör fort. „Wenn ich fragen darf“, fügt er noch hastig hinzu.
Ich zucke die Schultern. Wie soll ich ihm das erklären?
„Ich bin depressiv“, sage ich schließlich. Meine Diagnose lautet tatsächlich “leichte depressive Verstimmungen”.
„Hm“, brummt er. „Ein Freund von mir hatte das auch.“ Das „war“ ist mir nicht entgangen.
„Was ist passiert?“ frage ich.
„Er hat sich…“ Er schweigt einen Moment. Ich kann mir denken, was passiert ist.
„Ich wusste von nichts“, fügt er bitter hinzu. „Ich habe überhaupt keine Anzeichen bemerkt. Als ich es dann erfahren habe… Dass er sich…“ Er atmet tief durch. „Ich habe mir immer gesagt, dass ich es hätte merken müssen. Dass ich ihm hätte helfen müssen.“
„Mein Mann weiß auch von nichts“, sage ich, um ihn zu trösten.
Ich merke, dass er zusammenzuckt.
„Er weiß nicht, dass du depressiv bist?“
„Er sagt, ich soll mich nicht so anstellen.“
Mein Retter schweigt einen Moment. „Ich bringe dich zu deinem Mann“, sagt er dann fest.
„Nein!“
„Er muss es wissen. Er hätte es sowieso erfahren, wenn das da geklappt hätte.“ Unsensibel weist er in Richtung Gleise.
Ich zucke zusammen. Er seufzt.
„Du musst ihm irgendwann gegenübertreten. Macht er sich keine Sorgen?“
„Er denkt, ich treffe mich mit ein paar Freundinnen.“
„Hm. Ich bin übrigens Tom.“
„Melanie.“
„Komm.“ Er ergreift meine Hand und hilft mir auf. Ein Grummeln in der Ferne. Er packt mich und hält mich fest. Er hat wirklich Angst, dass ich es noch einmal versuchen könnte. Dabei hat es mir für diese Nacht wirklich gereicht. Er hält mich fest. Ich kann seine Muskeln spüren. Der Zug donnert vorbei. Ein Regionalexpress. Tom lässt mich erst los, als nichts mehr zu sehen und zu hören ist.
„Komm“, sagt er. Wir laufen ein Stück den Bahnweg entlang und biegen dann in eine nahegelegene Siedlung ab. Vor einem der zahlreichen schmucken Einfamilienhäuser bleibt er stehen. Er schließt auf. „Komm rein“, sagt er und macht Licht.
Ich sehe ihn zum ersten Mal richtig. Durchschnittlich groß, dunkelblondes Haar, blaue Augen. Ich schätze ihn auf Ende 30. Keine sonderlich markanten Gesichtszüge. Die Augen stehen etwas zu weit auseinander, die Nase ist etwas zu groß, als dass man ihn gutaussehend nenne könnte. Doch das ist gerade natürlich nicht wesentlich. Offenbar war er joggen, als er mich auf den Gleisen gefunden hat. Er wirkt auch ziemlich durchtrainiert.
„Gib mir einen Moment“, bittet er mich. „Lauf nicht weg. OK? Ich bin gleich wieder da.“
Ich setze mich auf eine Holzbank im Flur. Im Schuhregal stehen nur Männerschuhe.
Er ist tatsächlich gleich wieder da. Anscheinend hat er sich nur einen Pulli angezogen. In seiner Hand hält er Autoschlüssel. Er wirkt noch immer so, als ob er eine Dusche gebrauchen könnte. Ich folge ihm in die Garage. Darin steht ein großer BMW. Ich setzte mich auf den Beifahrersitz. Tom fährt mich zu mir nach Hause und erklärt meinem Mann alles. Mein Mann dreht völlig durch. Tom nimmt mich in Schutz. Er bietet mir an, bei ihm zu übernachten. Ich stimme zu. Er überredet mich zu einer Therapie. Ich werde geheilt und ziehe bei ihm ein. Und wenn wir nicht gestorben sind… Nein. Ich schüttle ich in Gedanken den Kopf. Was ich mir manchmal so zusammenphantasiere… Selbst wenn jemand kommen, mich retten – und dann auch noch Interesse an mir haben sollte… Ach was, eigentlich ist das völlig unmöglich. Erstens bin ich ja verheiratet. Dass es nicht klappt, liegt nicht an meinem Mann, sondern an mir. Wer sagt denn, dass es mit einem anderen Mann besser funktionieren würde? Zweitens würde niemand eine verrückte Selbstmörderin haben wollen, sondern sie sofort in die Klapsmühle abschieben. Drittens liegt die Chance, dass ich von einem halbwegs gutaussehenden Mann, der in etwa in meinem Alter ist, gerettet werde, höchstwahrscheinlich bei 0,5 Prozent.
Ich lausche weiter der Stille. Irgendwo fährt ein Auto durch die Nacht. Etwas raschelt in einem Gebüsch ganz in der Nähe. Ein Vogel, denke ich. Mein Körper ist zu steif, um mich umzudrehen und hinzuschauen. Eigentlich ist es mir auch egal. Plötzlich kläfft mir etwas direkt ins Ohr. Ich fahre hoch. Dabei erschrecke ich den doofen Pudel, der sich an mich herangeschlichen hat. Das Vieh macht einen Satz rückwärts und beginnt, mich aggressiv anzuknurren.
„Ja, wie können Sie denn mein Bienchen so erschrecken! Was machen Sie denn da überhaupt?“ Auf dem Gehweg, etwa 10 Meter entfernt, steht eine Gestalt. Den Umrissen nach eine Frau, der Stimme nach sicherlich über 70 Jahre alt. Ich rapple mich auf, lasse die Gleise hinter mir, rutsche die Böschung hinunter und trete auf den Fußweg. Der Pudel folgt mir und kläfft noch immer. Mein Plan besteht jetzt darin, die Dame zu beruhigen und mich dann ganz schnell aus dem Staub zu machen. In der Ferne höre ich ein Donnern. Der ICE nach Berlin. Natürlich wie immer zu spät. Ich überlege, auf die Gleise zurückzuspringen. Doch ich will keine Sauerei veranstalten, wenn ältere Damen und dumme Pudel in der Nähe sind.
„Bienchen? Bienchen!“ beginnt sie zu rufen. Der Pudel ignoriert sie und kläfft und knurrt weiter in meine Richtung. Der Zug rauscht an uns vorbei.
Zwei Schatten kommen herbeigeeilt – den Umrissen nach zwei Männer.
„Alles in Ordnung?“, keucht einer von ihnen. Der Stimme nach gehört er wohl zu der älteren Dame mit dem Pudel.
„Alles in Ordnung!“ Ich hebe begütigend beide Hände. Einen Moment lang überlege ich, einfach mein Heil in der Flucht zu suchen. Doch da ist noch der zweite Schatten, der enganliegende Kleidung trägt und durchtrainiert aussieht. Mir steht nicht so der Sinn nach einer nächtlichen Verfolgungsjagd über die Gleise. Mein Herz klopft laut in meiner Brust.
„Kommen Sie, setzen Sie sich doch“, sagt der ältere Mann und führt mich zu einer Bank in der Nähe. Ich nehme gehorsam Platz.
„Warum machen Sie denn so etwas?“ fragt er väterlich-besorgt.
Meine neue Strategie besteht darin, einen möglichst vernünftigen Eindruck zu hinterlassen. Also erkläre ich ihm, dass das doch alles viel Schlimmer aussah als es wirklich war und dass ich einfach auf den Gleisen gestolpert bin. Ein weiterer Zug donnert vorbei. Der Regionalexpress. Ich diskutiere ein paar Minuten mit den beiden älteren Herrschaften. Der durchtrainierte Schatten ist verschwunden. Da kommt ein Auto den Feldweg angefahren. Ein Polizeiwagen. Ich springe erschrocken auf.
„Jetzt beruhigen Sie sich“, sagt der ältere Mann. „Der junge Mann hat die Polizei gerufen. Wir können Sie doch nicht allein hier lassen.“
Noch einmal überlege ich, einfach davonzurennen, aber wenn jetzt auch noch die Polizei im Spiel ist, habe ich vermutlich schlechte Karten.
Die Beamten kommen aus dem Wagen direkt auf mich zu. Sie mustern mich. Wohl, um einzuschätzen, ob ich potenziell gefährlich bin – für mich und für andere.
„Sie lag auf den Gleisen!“ ruft der ältere Mann aufgeregt. „Sie wollte sich umbringen! Und sie hat uns erzählt, dass sie auf den Gleisen gestolpert ist. Sie müssen sie unbedingt mitnehmen!“
Die Beamten mustern mich nochmals eindringlich. Dann tastet mich die Beamtin ab. Natürlich habe ich nichts Scharfes bei mir – außer meinem Autoschlüssel. Immerhin liest sie mir nicht meine Rechte vor. Stattdessen werde ich in den Wagen verfrachtet. Ich bin noch nie in einem Polizeiwagen gesessen und hätte auf diese Erfahrung auch gut verzichten können.
Die Beamten fahren mich zu einem Krankenhaus. Offenbar haben sie mich angekündigt, denn davor wartet schon ein kleines Empfangskomitee. Ich werde untersucht. Natürlich bin ich unverletzt. Das versuche ich ihnen auch zu erklären, aber sie glauben mir erst, als sie mich untersucht haben. Die Narben der Schnittverletzungen an meinem Unterarm sind ihnen nicht entgangen. Aber sie sehen, dass diese schon mehrere Jahre alt sind und lassen mich in Ruhe. Damit zumindest. Ich muss meine Schuhe ausziehen und bekomme ein Bett in einem Krankenzimmer zugewiesen. Meine Zimmergenossin mustert mich misstrauisch. Sie ist etwa 40 Jahre alt und sieht ziemlich fertig aus. Vermutlich so ähnlich wie ich.
Ich setze mich auf das Bett. Im Nachttisch finde ich eine Bibel. Ich schlage zufällig das Buch Kohelet auf und beginne, darin zu lesen. „Wie gut haben es die Toten! Ihnen geht es besser als den Lebenden. Noch besser sind die dran, die gar nicht geboren wurden und die Ungerechtigkeit auf der Erde nicht sehen mussten.“ Und außerdem: „Eine Fehlgeburt hat es besser. Als ein Nichts kommt sie, in die Nacht geht sie, namenlos und vergessen. Das Sonnenlicht sieht sie nicht, was Leben ist, weiß sie nicht, aber Ruhe hat sie gefunden.“
Ich stelle fest, dass ich die Totgeburt beneide und den Prediger Kohelet sehr gut verstehen kann.
Die Tür geht auf. Herein kommt mein Mann mit unserem kleinsten Trolley-Koffer. Er ist bleich und wirkt verstört. „Was – warum?“ fragt er und starrt mich an. Dann lässt er den Trolley fallen, kommt auf mich zu, setzt sich neben mich und nimmt mich in seine Arme. Ich sitze reglos da wie ein Stein und kann mich nicht bewegen.
Er redet auf mich ein, doch ich bleibe stumm. Ich habe noch nie die Worte gefunden, um ihm irgend etwas zu erklären. Meine Narben zum Beispiel. Er hat immer alles hingenommen und nie hinterfragt. Für ihn bin ich gesund, meine Narben sind Vergangenheit. Eine Dummheit, die ich einst begangen habe. Auch heute kann ich nicht mit ihm reden und warte nur darauf, dass er wieder geht.
Ich bleibe über Nacht. In fremden Betten schlafe ich immer schlecht. Meine Zimmergenossin schnarcht. Leiser als mein Mann, aber das hilft mir nicht viel.
Um 7 Uhr poltert eine Krankenschwester in meinen Schlaf, der sich doch irgendwann eingestellt haben muss und reißt die Vorhänge auf. Um 8 Uhr gibt es Frühstück. Lauter fremde Leute um mich herum. Die meisten beachten mich genauso wenig wie ich sie. Ich bin müde und will einfach nur meine Ruhe. Das ist doch wohl nicht zu viel verlangt. Um 9 Uhr spreche ich mit einem Psychologen. Oder Psychiater? Ich weiß es nicht. Ist mir auch egal. Ich erkläre ihm, dass es sich um eine Kurzschlussreaktion gehandelt hat und dass es nicht wieder vorkommen wird. Er glaubt mir nicht und sagt, dass ich noch dableiben soll.
Am Nachmittag kommt mein Vater. Er packt mich und drückt mich fest an sich. „Kind, was machst du für Sachen?“ fragt er mich. Ich bin müde, fertig, verloren, ich kann gerade keine Berührungen ertragen. Ich stoße ihn mit aller Kraft von mir weg und schreie: „Fass mich nicht an!“
„Bist du völlig bescheuert? Ich bin dein Vater, ich darf das!“ brüllt er los, so, wie er es früher auch immer getan hat. Pfleger stürzen auf mich zu, halten mich fest, jagen mir eine Spritze in den Arm, fixieren mich auf meinem Bett. Mein Vater streicht mir sanft über die Stirn. Ich hasse dieses Gefühl des Ausgeliefertseins, ich ertrage das nicht mehr….
Allein die Vorstellung lässt mich zittern. Das wird nicht passieren, versuche ich mich zu beruhigen. Nicht in diesem Leben.
320 Tonnen Stahl donnern heran. Die kreischenden Räder zermalmen einen Tannenzapfen, der auf den Gleisen liegt. Ich sitze etwa zwanzig Meter entfernt, an einen Baumstamm gelehnt. Niemand hat mich gerettet. Wer soll sich auch um Mitternacht an diesen einsamen Streckenabschnitt verirren? Schließlich habe ich diesen genau deswegen ausgesucht.
Aber ich konnte es nicht tun. Was würde mein Mann denken? Was meine Mutter? Was würde ich dem Zugführer damit antun? Es ging einfach nicht.
Es ist nichts passiert. Dennoch klopft mein Herz wie verrückt. Ich stehe langsam auf, gehe zurück zu meinem Auto, steige ein und fahre nach Hause.
Mein Mann ist noch wach. Er sitzt vor dem Fernseher und schaut Fußball. „Wie war es bei deinem Mädelsabend, Schatz?“ fragt er. Er hat nichts gemerkt. Er weiß nicht, dass mein Kopf heute auf den Gleisen gelegen hat. Er weiß nicht, wie sich 320 Tonnen Stahl anhören, die mit 200 Stundenkilometern durch die Nacht rasen.
„Ich bin müde“, sage ich. Er fragt nicht weiter. Ich gehe ins Bett. Mein Herz klopft noch immer deutlich in meiner Brust. Morgen wieder aufstehen. Sich in die Arbeit quälen. Lächeln, ohne dass mir nach einem Lächeln zumute ist. Und doch – etwas ist jetzt anders. Denn ich weiß jetzt, wie einfach es ist – wie lächerlich einfach – allem ein Ende zu setzen, wenn es sein muss. Die Generalprobe habe ich bestanden. Ich weiß, ich werde es schaffen, wenn es je wirklich soweit sein sollte. Doch bis dahin habe ich wohl noch etwas Zeit.
Diese Suizidgeschichte ist Teil des folgenden Büchleins:
Spielen Sie mit dem Gedanken, sich das Leben zu nehmen?
Bei der Telefonseelsorge finden Sie Menschen, die mit Ihnen reden. Per Mail, Chat oder am Telefon: 0800/1110111 und 0800/1110222