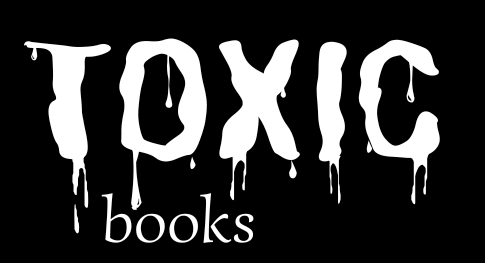Eine Kurzgeschichte von Miriam Malik
Beelitz Heilstätten, 1938
Heilstätte nennen sie es. Eine Stätte, die heilen soll. Eine Stätte voll Kranker, zusammengepfercht in hellen Räumen, die nicht darüber hinwegtäuschen können, dass manche, wenn nicht sogar viele von uns diese sogenannten Heilstätten nicht überleben werden.
Kalte Bäder, frische Luft, ausruhen auf dem Sonnenbalkon und Bettruhe verordnen sie uns hier. Ruhe. Wie soll man zur Ruhe kommen, wenn jeder um dich herum den ganzen Tag hustet? Ein schweres, röchelndes, rasselndes Husten, das die Heilstätten Tag und Nacht beherrscht, dazu der Gestank von Blut, Auflösung, Tod. Die Krankenschwestern geben sich Mühe, alles sauber zu halten, aber sie können nicht überall zur gleichen Zeit sein, dazu sind es viel zu wenige.
Ich liege wach. Es wird bereits hell draußen. Klara neben mir hustet nicht mehr. Schläft sie? Und wenn ja – wacht sie wieder auf? Ich mag sie, sie lächelt immer, wenn auch auf diese traurige Weise.
Auf der anderen Seite liegt Gerda. Sie pfeift leise. Besonders dieses Geräusch lässt mich nicht schlafen. Ein scharfer, dennoch irgendwie hohl klingender Pfeifton, der immer leiser wird, nur um erneut wieder anzuschwellen. Ich weiß, dass Gerda nichts dafürkann. Die Ärzte haben einen chirurgischen Eingriff an ihr vorgenommen und einen ihrer Lungenflügel kollabieren lassen. Alle paar Wochen leiten sie Gas hinein, warum, habe ich nicht genau verstanden. Ich weiß, dass Gerda nichts kann für dieses Pfeifen, aber es hält mich wach und lässt mich nicht schlafen.
Endlich lugt die Sonne über die Fensterbank und hangelt mit ihren warmen Strahlen nach uns. Die Schwester kommt herein, wünscht laut in grimmigem Ton „Guten Morgen!“, geht durch die Reihen. An Klaras Bett bleibt sie länger stehen als bei den anderen, dann zieht sie das Bettlaken über ihr Gesicht.
Es fühlt sich an wie ein Faustschlag in meinen Magen. Ich drehe den Kopf. Jetzt habe ich das Bild vom Führer im Blick. Meine Augen sind schlecht, deswegen kann ich sein Gesicht nicht erkennen. Vielleicht fühle ich mich deswegen ständig von ihm beobachtet. Ich weiß ja nicht, wohin er blickt. Sicher auf mich.
Ich kann mir vorstellen, wie er finster die Brauen runzelt. Leider bin ich nicht das deutsche Mädel, das er sich gewünscht hat. Klein, dunkle Haare, blind wie ein Maulwurf. Beim BDM war ich immer die letzte und schwächste, egal, ob wir wandern gingen oder im See schwammen, und wenn wir antreten mussten, war immer ich es, die es schaffte, einen Fleck auf der Bluse zu haben oder ein Loch im Strumpf. Und kaum war ich achtzehn Jahre alt, alt genug, um der Pflichtmitgliedschaft zu entfliehen, musste ich natürlich krank werden.
Eigentlich ist es hier nicht so schlecht, wenn nur der schreckliche Husten und das Röcheln und Pfeifen nicht wären. Und die Toten. Und die Schatten.
Schon gibt es Frühstück. Nie habe ich besseres Frühstück gegessen als hier. Seit ich denken kann, gab es im Hause meiner Eltern nur ein Schälchen faden Haferschleim. Hier bekommen wir weiches, frisches Brot, süße Marmelade und würzigen Käse.
Nach dem Frühstück werden wir auf den Sonnenbalkon gescheucht, wo wir in eng aneinandergestellten Betten liegen und uns die Sonne ins Gesicht scheinen lassen. Reden ist verboten. Husten nicht. Dennoch ist es besser, als in der Fabrik zu schuften. Es ist auch besser, als in unsere feuchte, enge Wohnung zurückzukehren, zu Papa, Mama und meinen jüngeren Geschwistern. Gut, dass Klaus, mein älterer Bruder, endlich ausgezogen ist. Er hat dank der Partei einen Job bekommen. Jedes Mal, wenn er zuhause ist, beschwört er meinen Vater, auch beizutreten, doch der weigert sich noch immer hartnäckig, vor allem deswegen, weil sein Jugendfeind jetzt der Blockleiter ist, und das auch nur, weil er seine arische Abstammung bis 1800 lückenlos nachweisen kann.
Das hat meinen Vater aber nicht daran gehindert, mich hier einzuweisen. Alle sind angehalten, Tuberkulosekranke zu melden und in einer Heilstätte unterzubringen. Die Volksgesundheit geht vor. Und ich war sowieso ein unnützer Esser zu viel. Besser nicht weiter darüber nachdenken.
Ich genieße die Sonne auf meiner Haut, ich glaube fast, sie lindert tatsächlich das Brennen und Rasseln in meiner Brust. Die warmen Strahlen liebkosen mich. Wie unerfreulich, dass ich erst krank werden musste, um in solchen Genuss zu kommen.
Was Heinrich wohl gerade macht? Wir haben in der gleichen Fabrik gearbeitet. Er hat mir immer zugezwinkert. Zu mehr sind wir bisher nicht gekommen, immer fuhr einer der leitenden Angestellten dazwischen und brüllte uns an, dass wir gefälligst arbeiten gehen sollten … Wenn ich hier rauskomme, werde ich ihn fragen, wo er wohnt. So wahr mir Gott helfe!
Das Glöckchen ertönt, Zeit, wieder nach drinnen zu gehen. Die Sonne versteckt sich hinter einer Wolke und da sind sie, die Schatten. Ich muss mich zwingen, den Pavillon zu betreten. Überall sind sie, sie gleiten durch die Räume und die Menschen hindurch wie Gespenster. Außer mir kann sie keiner sehen. Ich habe mehrere Mitpatientinnen und eine der netteren Schwestern nach ihnen gefragt und nur verständnislose Blicke geerntet. Sie machen mir angst, diese Schatten, und jedes Mal, wenn mich einer von ihnen streift, glaube ich, Kälte zu verspüren. Bei manchen weniger, bei anderen mehr.
„Friederike, Anna, Elisabeth“, ruft die Schwester. „Es ist an der Zeit, ins Bad zu gehen.“
Bald darauf versammeln wir uns in der Eingangshalle, eine Gruppe von zehn, zwölf Frauen. Ich habe keinen Blick für sie. Fassungslos stelle ich fest, dass ich vier der Schatten deutlicher sehe als andere. Drei davon sind junge Mädchen, vielleicht so alt wie ich, aber … Ich spüre, wie mir die Schamesröte ins Gesicht steigt. Sie sind nur unzureichend bekleidet, tragen knappe Höschen und Büstenhalter aus schwarzem Leder, so scheint es mir, ähnlich wie das Zaumzeug eines Pferdes. Sie winden sich am Boden vor einem Mann, der ein merkwürdiges Gerät bedient, das auf einem Ständer befestigt ist. Zum Glück ist wenigstens der Mann vollständig bekleidet. Was treiben sie da nur?
„Gehen wir“, meint die Schwester fröhlich.
Wir verlassen den Frauenpavillon und ich bin froh darum, bis ich feststelle, dass der Mann den merkwürdigen Apparat geschultert hat und mit einem der Mädchen vor uns herläuft. Mich überläuft es eiskalt. Ich spüre etwas Kaltes, Böses, Finsteres. Etwas Schreckliches wird geschehen, das weiß ich genau … Da nimmt der Mann mit der Frau in einen anderen Weg. Gott sei Dank. Sofort ist mir leichter ums Herz. Das sollte es nicht, die Frau schwebt doch noch immer in Gefahr, das spüre ich genau, aber trotzdem … Aus den Augen, aus dem Sinn … Ich schäme mich.
Bald stehen wir vor dem gewaltigen Zentralbad, ein besonders prachtvoller Bau, mit einem kleinen Walmdach über dem Giebel, vielen Fenstern, hübschem Fachwerk und einem kleinen Türmchen. Als wir das Gebäude betreten wollen, fahre ich erschrocken zusammen. Männer mit Fackeln laufen uns entgegen, ihre Haare wehen, sie tragen Krankenhauskleidung und sind umgeben von Männern mit schweren Apparaten, die sowohl rückwärts vor ihnen herlaufen und als ihnen auch folgen …
„Komm schon, Friederike“, sagte die Schwester zu mir. „Ein schönes Bad hat noch keinem geschadet.“
Verstört folge ich ihr nach drinnen. Die Männer sind hinausgelaufen, versuche ich mir zu sagen. Im Haus bin ich also vor ihnen sicher.
Wir ziehen unsere Badekleider an und begeben uns in den großen Badepavillon. Ich bleibe auf der Schwelle stehen, mein Herz schlägt wie verrückt in meiner Brust. Aus dem Wasserbecken in der Mitte steigt dunkelroter Nebel, darin sehe ich schattenhafte Gestalten, die hektisch die Arme bewegen. Ich will davonlaufen, doch ich kann nicht, ich kann mich nicht rühren und starre weiter in den Nebel, der sich langsam lichtet. Ich sehe drei oder vier Männer, halbnackt, aber ihre Gesichter sind vermummt, und sie spielen Cello. Auch sie sind umgeben von dunkel gekleideten Männern, die sie beobachten … Welch ein bizarrer Anblick.
Elisabeth bemerkt sie nicht, sie steigt einfach zu ihnen in den roten Nebel hinein und schreit: „Es ist eiskalt!“
In dem Moment kommt mir der Fußboden entgegen.
Benommen nehme ich wahr, wie zwei Schwestern herbeieilen. Ich werde in ein Zimmer getragen und auf eine Liege gebettet.
Bald darauf kommen ein Arzt und eine junge Schwester. „Sie haben einen uns einen schönen Schrecken eingejagt.“ Er hört meine Brust ab.
„Kann … kann ein Ort böse sein?“, frage ich leise. „Kann ein Ort Menschen böse machen?“
Der Arzt hält inne und lächelt mich freundlich an.
„Nein, natürlich nicht.“ Ich spüre, wie er in Gedanken ein „Dummchen“ hinzufügt. „Wie soll Gott die Menschen richten, wenn ein Ort ihnen die Saat des Teufels eingepflanzt hat? Gott würde nicht zulassen, dass solch ein Ort existiert. Vertraue auf Gott, mein Kind, dann wird alles in Ordnung sein.“
Er horcht weiter an mir herum. Schließlich wendet er sich an die Schwester. „Bringen Sie sie zurück zum Frauenpavillon. Nehmen Sie einen der Rollstühle dafür. Und machen Sie für morgen einen Termin in der Chirurgie für Fräulein Friederike aus.“
„Die Chirurgie?“, frage ich tonlos.
„Ihr rechter Lungenflügel scheint mir noch ganz in Ordnung zu sein, ich denke, wir können einen Eingriff bei Ihnen wagen. Bringen Sie sie weg, Martina.“
Martina hilft mir, aufzustehen und geleitet mich durch die Gänge in die Eingangshalle. Dabei werden wir von den Schattenmännern überholt. Ich zucke zusammen und kann nur mit Mühe einen Aufschrei unterdrücken, als eine der Fackeln vor meine Füße fällt und zu brennen beginnt. Martina schiebt mich durch die Flamme nach draußen. Mühsam ringe ich nach Luft.
„Setzten Sie sich.“ Sie lässt mich auf der Treppe zurück.
Erneut stürmen die Männer mit den Fackeln an mir vorbei.
Schwester Martina kommt kurz darauf mit einem Rollstuhl wieder, hilft mir hinein und schiebt mich an. Ich bin froh, als wir das Badehaus hinter uns gelassen haben.
„Warum haben Sie gefragt, ob dieser Ort böse ist?“, fragt Martina mit rauer Stimme.
„Ich …“ Wie soll ich ihr die Schatten erklären? „Hier stimmt etwas nicht“, sage ich lahm. „An diesem Ort …“ Ich verstumme.
Sie schweigt.
Ich starre zu Boden. Ich will die Schatten nicht sehen, die überall um uns herum sind. Martina hält an und ich blicke hoch. Ein Frösteln überfällt mich.
„Das ist nicht der Frauenpavillon“, stelle ich fest und muss husten.
„Nein, das ist die Waschküche“, sagt Martina.
„Was wollen wir hier?“, frage ich leise mit einer unguten Vorahnung.
„Ich möchte Ihnen etwas zeigen.“ Die Schwester packt mich am Arm und führt mich in das Gebäude hinein. Es ist schwül und dampfig hier drin und es riecht penetrant nach Seifenlauge.
Wir ernten fragende Blicke, doch Schwester Martina blickt überaus grimmig drein, vielleicht traut sich deswegen niemand, uns anzusprechen, und dazu sind die Frauen damit beschäftigt, körbeweise Wäsche hin- und herzuschleppen, frische saubere genauso wie blutige und dreckige Bettbezüge.
Wir betreten einen Raum mit mehreren Waschzubern. Abrupt bleibe ich stehen und starre nach oben. Etwa einen Meter über mir sehe ich einen Schatten. Ich kann ihn nicht richtig erkennen, aber da ist etwas, unzweifelhaft, und es ist eiskalt …
„Wenn ich hier stehe, spüre ich unglaubliche Einsamkeit“, sagt Martina neben mir.
„Ich sehe einen Schatten“, krächze ich. „Ich spüre eisige Kälte.“
„Ich höre ein schreckliches Stöhnen“, plärrt mir eine Stimme ins Ohr. „Dabei höre ich sonst so schlecht.“
Ich fahre herum. Eine Wäscherin hat ihren Korb mit sauberer Wäsche abgestellt und sieht mich an. „Geister, vermute ich.“
Meine Knie werden weich, Martina packt mich fest am Arm.
Ich muss husten. „Ich möchte nach draußen“, flehe ich.
Die Schwester und die Wäscherin helfen mir gemeinsam hinaus. Ich sinke in den Rollstuhl und kann nicht aufhören zu husten. Martina fährt mich ein Stück in den Park hinein. In einigem Abstand zur Waschküche bleiben wir stehen. Die Wäscherin und Martina warten geduldig, bis ich fertig gehustet habe. Mein ganzes Taschentuch ist voller Blut.
„Du bist kreidebleich“, stellt die Wäscherin mit ihrer lauten, schrillen Stimme fest.
Ich nicke stumm.
„Ich bin übrigens Gisela.“
„Geister“, flüstere ich. Es gibt sie also wirklich. Das stimmt nicht mit diesem Ort.
„Ja, Geister“, knurrt Martina.
„Wir … wir müssen etwas tun“, sage ich.
„Und was?“, fragt die Wäscherin.
„Wir können nicht hierbleiben“, sage ich.
„Die Geister können uns immerhin kein Leid zufügen“, sagt Martina bitter. „Vor den Lebenden müssen wir uns viel mehr fürchten.“
Mir läuft es eiskalt über den Rücken. Ich möchte nicht wissen, was ihr widerfahren ist.
„Um deine Frage zu beantworten, ich glaube nicht, dass dieser Ort böse ist“, sagt Martina etwas ruhiger. „Ich glaube nur, hier funktioniert die Wahrnehmung anders. Man spürt Dinge, die man sonst nicht spüren kann. Man sieht Dinge … Man hört Dinge … Wenn man dafür empfänglich ist.“
„Immerhin weiß ich jetzt, dass ich nicht verrückt bin“, murmle ich.
Martina und die Wäscherin nicken.
„Das hat es auch für uns leichter gemacht“, fügt Gisela hinzu.
„Und jetzt?“, frage ich.
„Jetzt bringe ich dich in dein Bett und mache einen Termin bei der Chirurgie für dich aus.“
„Und … die Geister?“
„Ich glaube nicht, dass wir etwas tun können“, sagt Gisela.
„Da ist ein Mann, der merkwürdige Dinge mit mehreren Mädchen im Frauenpavillon tut. Eine folgt ihm später in Richtung Sanatorium“, sage ich leise. „Es … es ist nicht gut.“
„Ja, manche spürt man besser als andere“, nickt Gisela. „Es gibt eine Stelle im Wald, vielleicht fünfhundert Meter von hier … Ich höre immer lauter Schreie, wenn ich dort vorbeigehe.“
„Ich spüre dort Angst, Todesangst“, sagt Martina knapp.
„So viel Böses ist hier“, nicke ich verzagt. „Aber der Arzt hat recht. Wenn der Ort die Menschen böse macht, sind sie ja nicht mehr für ihre Taten verantwortlich. Dann könnte jeder, der in Beelitz war, behaupten: Ich bin unschuldig, es liegt an den Heilstätten.“
„Ja, das wäre zu einfach“, sagt Gisela. „Ich denke auch nicht, dass es am Ort selbst liegt. Aber so, wie wir Dinge sehen und fühlen, die wir sonst nicht wahrnehmen … Vielleicht sind Menschen hier besonders empfänglich für bestimmte Neigungen.“
„Oder der Ort zieht böse Menschen an, die wissen, dass hier schlimme Dinge passiert sind“, sage ich.
„Ich muss zurück“, sagt Gisela. „Wenn die Leiterin merkt, dass ich fehle … Kannst du laufen, Mädchen? Martina, kannst du die Wäsche nehmen?“
Wir verabschieden uns und legen die wenigen Meter zum Pavillon zurück.
„Friederike, da sind Sie ja endlich!“ Eine Schwester eilt aufgeregt auf mich zu. „Frau Elisabeth hat uns von Ihrem Schwächeanfall berichtet. Wir waren schon in Sorge!“
„Die frische Luft hat ihr gutgetan“, sagt Martina. „Sie kann schon wieder alleine laufen.“ Sie nickt mir zu und geht.
Ich bekomme etwas zu essen und darf mich wieder auf den Balkon legen. Sofort versinke ich in meinen Gedanken. Wieso scheinen die Schatten so viel düsterer zu sein als das Leid, das mich hier umgibt, das Leid der Kranken, der Sterbenden, der Toten? Die Cellospieler fallen mir ein und die Männer mit den Fackeln. Bei ihnen hatte ich Angst, aber nicht so viel Angst wie bei dem Mann, der das Mädchen begleitet hat. Und nicht so viel Angst wie beim Schatten in der Wäscherei. Merkwürdig, all das … Ich muss erneut husten, oh, so schlimm husten …
Endlich lässt der Reiz nach. Erschöpft sinke ich auf mein blutiges Kopfkissen, ich habe nicht die Kraft, es wegzuschieben. Keine Schwester kommt, um mir zu helfen, aber ich weiß, dass ich mich freuen kann, dass ich überhaupt hier in der Sonne liege. In anderen Anstalten dürfen die Menschen kaum mehr das Bett verlassen, hat uns eine der netten Schwestern erzählt. Dort sind zu wenig Pfleger. Dort kommen die Menschen zum Sterben hin, kaum jemand kehrt wieder zurück …
Gerda neben mir beginnt erneut laut zu pfeifen. Sie muss ebenfalls eingeschlafen sein.
Gerda pfeift.
Elisabeth schnarcht.
Anna hustet.
Ihr Schatten, wer ihr auch seid, ihr habt keine Macht mehr über mich. Ich habe keine Kraft mehr, um mir über euch Gedanken zu machen. Ich habe eine Schwelle erreicht, eine dunkle Tür, durch die ich wohl bald gehen muss. Vielleicht bin ich dann eine von euch.
Kann ein Ort böse sein?
Nein, ich glaube nicht.
Ein Ort ist einfach. Egal, ob dort Wald steht oder Gebäude, er trotz der Zeit, den Jahren, den Jahrzehnten, und wir sind ihm völlig egal.
Ein Ort ist einfach.
Es sind die Menschen allein, die wir fürchten müssen.
Mehr von Miriam Malik lesen

Willst du mehr über die Heilstätten von Beelitz wissen?
Mehr über die Beelitzer Heilstätten erfahren
Weitere Bücher und Filme rund um die Heilstätten bei amazon ansehen: